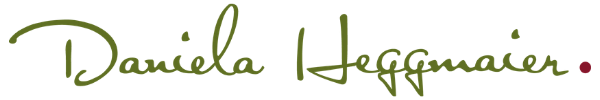Ob Linkhaftung, DSGVO, ePrivacy Verordnung oder Leistungsschutzrecht: Selbstständige und Angestellte müssen sich in ihrer Selbst-PR im Netz mit rechtlichen Vorschriften vertraut machen. Viele sind unsicher, wenn es um die Kennzeichnung von Werbung, die Verlinkung von Marken oder Markierung von Personen, z.B. in Instagram geht. Darüber sowie über das Risiko des Identitätsdiebstahls habe ich in diesem Interview mit einem Experten gesprochen: Dr. Marc Maisch, er ist Rechtsanwalt und Datenschutzbeauftragter u.a. mit den Fachgebieten Internet-, Datenschutz- sowie Vertragsrecht.
Daniela Heggmaier: Was darf ich denn überhaupt noch teilen?
Dr. Marc Maisch: „Eigentlich ist es ganz einfach: Sie dürfen alle Inhalte teilen, die legal sind. Inhalte dürfen also nicht gegen Gesetze verstoßen oder Rechte anderer Personen verletzen. Was erlaubt ist und was nicht, hängt vom jeweiligen Inhalt ab. Presse- und Telemedienrecht, das Urheber-, Marken- und Wettbewerbsrecht enthalten viele Grundregeln, die man kennen sollte.
Wer gewerblich Inhalte veröffentlicht, ganz gleich ob über einen Blog, Instagram oder einen Newsletter, muss z.B. ein Impressum haben. Werbung muss eindeutig gekennzeichnet werden, aber dazu später mehr. Bitte denken Sie auch an das Strafrecht – wer z.B. Beleidigungen, übliche Nachrede, sexuelle Inhalte oder fremdenfeindliche Inhalte teilt (auch wenn er selbst nicht Autor ist), kann sich ggf. auch selbst strafbar machen oder riskiert seinen Arbeitsplatz.
Seien Sie bitte vorsichtig mit Sätzen wie ‚Wir bei FIRMA XYZ…‘. Dadurch kann der Eindruck entstehen, dass Sie für den Arbeitgeber sprechen. Für Rechtsverletzungen, z.B. bei fehlender Werbekennzeichnung kann es sein, dass Ihr Arbeitgeber mithaftet. Bei öffentlicher Kritik oder sonstigen Äußerungen über den Arbeitgeber sollten Sie daher stets betonen, dass Ihr Inhalt als Ihre persönliche Meinung aufzufassen ist und Sie nicht im Namen des Arbeitgebers sprechen, um Regressansprüche zu vermeiden.“
Daniela Heggmaier: Hafte ich auch für fremde Inhalte?
Dr. Marc Maisch: „Wer fremde Inhalte so übernimmt, dass sie erkennbar als eigene Äußerung erscheinen, haftet für diese vollumfänglich wie für eigene Inhalte. Juristen sprechen vom ‚Zueigenmachen‘ fremder Inhalte. Bloßes, kommentarloses Teilen reicht jedoch noch nicht aus. Ein Zueigenmachen liegt nach der Rechtsprechung aber dann vor, wenn ein fremder Post mit einer positiven Leseempfehlung oder mit einem ‚Gefällt-mir‘ versehen wird (OLG Dresden, Urteil vom 07. Februar 2017 – 4 U 1419/16). Wer auf seinem Blog z.B. Gastbeiträge anderer Blogger oder Unternehmer veröffentlicht, sollte diese als Gastbeiträge eindeutig kennzeichnen, um nicht ggf. für deren Urheberrechtsverletzungen zu haften (BGH „Marions Kochbuch“ v. 12.11.2009, Az. I ZR 166/07).
Eine Haftung für fremde Inhalte ist auch durch Nutzerkommentare oder User-Generated-Content möglich. Gemäß § 10 TMG haftet ein Diensteanbieter, z.B. ein Blogger oder Fanpage-Betreiber für fremde Inhalte in Kommentaren, ab dem Zeitpunkt, ab dem er Kenntnis von einer rechtswidrigen Handlung hat und nicht unverzüglich tätig geworden ist, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu sperren. Wer auf Nummer sicher gehen will, schaltet Nutzerkommentare, Zusendungen und Markierungen erst nach vorheriger Prüfung frei.“
Daniela Heggmaier: Hashtags und Verlinkungen/Markierungen von Marken und Personen: Wo sind Fallstricke?
Dr. Marc Maisch: „Wenn Beiträge, Websites oder andere Accounts verlinkt werden, kann man für die Verlinkung als sogenannter Störer haften, selbst wenn man selbst nicht Täter der Rechtsverletzung ist. Grundsätzlich beginnt die Störerhaftung für Hyperlinks, ab dem Zeitpunkt, in dem der Linksetzer Kenntnis von der Rechtsverletzung erlangt (BGH, Urteil vom 01.04.2004, Az.: I ZR 317/01). Bei professionellen Autoren, Influencern, Unternehmen sind die Gerichte strenger: Wer mit Gewinnerzielungsabsicht Links setzt, muss alle erforderlichen Nachprüfungen vorzunehmen, um Rechtsverletzungen (z.B. von Urheberrechten) auszuschließen (BGH, Urteil vom 08.09.2016, Rs. C-160/15). Dazu gehört auf jeden Fall, mit kritischem Auge einen Blick auf die verlinkte Seite zu werfen – wer ‚blind‘ einen Link setzt, handelt fahrlässig.
Hashtags können marken- und werberechtlich problematisch sein. Spätestens seit Frau Cathy Hummels und Frau Vreni Frost vor allem durch Rechtsstreitigkeiten wegen fehlender Werbekennzeichnungen bei Instagram der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden sind, ist eines klar: Die Kennzeichnungspflichten sind ein heißes Eisen. Werbung ist jede absatzfördernde Handlung, die dann als ‚Werbung‘ oder ‚Anzeige‘ zu kennzeichnen ist, wenn sie gewerblich erfolgt. Die Kriterien dazu sind noch nicht höchstrichterlich entschieden. Bereits das ‚Taggen‘ eines Unternehmens oder ein sprechender Link dazu, wurden in Instagram-Beiträgen bereits als Werbung zu kommerziellen Zwecken (u.a. KG Berlin, Beschluss vom 11.10.2017 – 5 W 221/17). Natürlich sind Beiträge als Werbung zu kennzeichnen, wenn ein Sponsoringvertrag besteht oder in sonstiger Weise eine Gegenleistung, ein Rabatt oder eine Überlassung von Sachen im Raum steht.
Wenn man durch zahlreiche Verlinkungen von populären Unternehmen die Auffindbarkeit seiner Postings erhöhen will, kann eine Rechtsverletzung auch dann vorliegen, wenn die Beiträge ordentlich gekennzeichnet wurden. An dieser Stelle sind Markenrechtsverletzungen möglich, da sich durch das ‚Unterschieben‘ von Werbung, Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche wegen Rufausbeutung gem. § 14 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 3 MarkenG begründen lassen.
Das Taggen von Personen kann auch zur Herstellung von Personenbezug führen. Diese Speicherung kann als Verarbeitung personenbezogener Daten den strengen Regeln der Datenschutz-Grundverordnung unterfallen, wenn ein Unternehmen am Werk ist. Privatpersonen, die rein zu privaten Zwecken bloggen, sind raus.“
Daniela Heggmaier: Wenn ich andere Marken verlinke, es aber weder bezahlte Werbung noch irgendeine Kooperation ist: Was soll ich z.B. in Instagram oder in meinem Blog dazuschreiben? Soll ich einfach mal alles als WERBUNG kennzeichnen?
Dr. Marc Maisch: „Das lässt sich pauschal schwer beantworten. In der Regel ist entscheidend, zu welchem Zweck etwas verlinkt wird und wie der redaktionelle Inhalt ausgestaltet wird. Jeder Post, der zu gewerblichen Zwecken erfolgt, also nicht aus rein privater Produktbegeisterung, kann eine geschäftliche Handlung mit kommerziellem Zweck darstellen (§ 5a Abs. 6, § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG), die als Werbung gekennzeichnet werden muss. Die Rechtsprechung hat da einige Kriterien aufgestellt, um zu bewerten, was dem Begriff Werbung unterfällt. Postings, die Zug um Zug für eine Gegenleistung, z.B. eine Provision oder einen Rabatt erfolgen, sind kennzeichnungspflichtig. Jedoch ist auch bei Postings ohne Gegenleistung eine Kennzeichnungspflicht nicht (sicher) ausgeschlossen. So entschied das Kammergericht in Berlin, dass die Verlinkung von Unternehmen nicht aus reiner Produktbegeisterung erfolgt, sondern der Absatzförderung dienen soll (KG Berlin, 11.10.2017 – 5 W 221/17).
Am Kammergericht in Berlin ist derzeit auch ein Verfahren um die in Influencerkreisen bekannte Vreni Frost rechtshängig, die sich gegen eine einstweilige Verfügung des Vereins zur Wahrung des lauteren Wettbewerbs zur Wehr setzt. In der Vorinstanz entschied das LG Berlin, dass jede Verlinkung im Instagram-Konto von Frau Frost auf ein anderes Unternehmen als geschäftliche Handlung anzusehen (und daher als Werbung zu kennzeichnen) sei, auch wenn die Bloggerin in Einzelfällen keine Gegenleistung erhalten hat (LG Berlin, Urteil v. 24.05.2018, Az. 52 O 101/18). Das Landgericht argumentiert, dass auch die Verlinkung der Präsentation des verlinkten Unternehmens diene. Eine unmittelbare Gegenleistung sei nicht erforderlich. Die Richter stellten auch darauf ab, dass Frau Vrost eine Projektmanagerin beschäftige und den Blog über ihre Geschäftsanschrift bei einer Werbeagentur betreibe. Es wird erwartet, dass das Kammergericht dieser weiten Auslegung des Begriffs der geschäftlichen Handlung gem. § 5a Abs. 6 UWG zumindest teilweise eine Absage erteilt. Das Urteil des Kammergerichts wird für Ende März erwartet.
Die Dauer-Werbekennzeichnung täuscht die Nutzer, daher rate ich davon ab. Accounts können zudem an Authentizität verlieren, wenn alles als Werbung gekennzeichnet ist. Ich empfehle Ihnen, sich bei der Erstellung von Postings an den Leitfäden der Landesmedienanstalten zu orientieren. Sehr übersichtlich finde ich diesen Leitfaden.
Wer als Auftraggeber einer Influencer-Kampagne oder als Influencer selbst rechtssichere Rahmenbedingungen für das Online-Marketing haben will, sollte sich von einem Rechtsanwalt beraten lassen.“
Daniela Heggmaier: Was muss ich bei Live Videos beachten?
Dr. Marc Maisch: „Streaming-Angebote, eben auch Live-Videos, können als gemäß § 2 RStV zulassungsbedürftig sein, wenn sie als ‚Rundfunk‘ bewertet werden. Rundfunk liegt vor bei Angeboten, die ‚linear‘ veranstaltet werden und für die Allgemeinheit entlang eines Sendeplans zum zeitgleichen Empfang bestimmt sind. ‚Entlang eines Sendeplans‘ bedeutet, dass Sendungen mit redaktioneller Gestaltung angeboten werden – ab wann diese Schwelle überschritten ist, kann schwierig zu beurteilen sein. Hier muss das Angebot im Einzelfall untersucht werden.
Derzeit prüfen die Landesmedienanstalten die Zulassungsbedürftigkeit von Lets-Play-Streaming-Angeboten z.B. bei Twich.tv – nicht zuletzt hier offenbart sich die Reformbedürftigkeit des Rundfunkstaatsvertrags, wie die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten (ZAK) selbst eingeräumt hat. Für eine Zulassung kann eine Gebühr von 1.000 – 10.000 Euro, je nach wirtschaftlichem Erfolg des Angebots, erhoben werden. Da Verstöße gegen die Zulassungspflicht gem. § 49 RStV mit Bußgeldern bis 500.000 € bewehrt sind, kann eine Vorabprüfung lohnend sein.
Ob verschiedene Live-Stream-Angebote von ‚BILD online‘: ‚BILD live‘ dem Rundfunkbegriff unterfallen, wird derzeit vom Verwaltungsgericht Berlin geklärt (VG Berlin, Beschluss vom 19.10.2018 – VG 27 L 364.18).
Wer nur Videos zum Abruf bereithält, kann aufatmen. Bei Live-Videos mit gewisser Regelmäßigkeit und redaktioneller Gestaltung der Sendung, ganz gleich über Facebook oder YouTube, sollte man genauer prüfen, ob ggf. von Rundfunk auszugehen und eine entsprechende Rundfunklizenz erworben werden muss.“
Daniela Heggmaier: Was ist zu beachten, wenn auf den Fotos, die ich in Social Media oder meinem Blog teilen will, andere Personen zu sehen sind?
Dr. Marc Maisch: „Wer Menschen fotografiert oder Fotos für das Internet verwenden will, sollte immer überlegen: Darf ich die Bilder verbreiten? Grundsätzlich ist die Verbreitung von Bildern, die eine natürliche Person erkennbar zeigen, nur erlaubt, wenn die Person vorher zugestimmt hat. Erkennbarkeit ist dann gegeben, wenn eine nahestehende Person den oder die Abgebildete namentlich identifizieren könnte. Fotos, bei denen Personen z.B. mit Helm auf dem Kopf usw. nicht von anderen Personen unterscheidbar sind, fallen aus dem Anwendungsbereich des Rechts am eigenen Bild.
Ist eine Person erkennbar und liegt die Zustimmung nicht (oder nicht nachweisbar) vor, muss immer geprüft werden, ob die Verbreitung nicht auf eine gesetzliche Ausnahmeregelung gestützt werden kann. Praxisrelevante Ausnahmen sind folgende Fälle: Eine abgebildete Person ist Bestandteil einer größeren Gruppe bei einer Versammlung. Eine weitere Ausnahme ist, wenn eine Person nur ‚Beiwerk‘ zur Landschaft darstellt. Ob eine Person lediglich Beiwerk ist, muss im Wege einer Bewertung des Bildmotivs untersucht werden. Man fragt: Was will mir das Bild sagen? Was ist das Kernmotiv? Ist die Bildaussage noch dieselbe, wenn man sich die abgebildete Person hinweg denkt?
Werden auf dem Bild Kinder gezeigt, ist ebenso eine Erlaubnis notwendig, dabei gilt: Bei einem Kind bis 14 Jahren genügt die Erlaubnis des Erziehungsberechtigten; ab der Vollendung des vierzehnten Lebensjahrs ist neben der der Eltern zusätzlich noch die Einwilligung des Kindes selbst notwendig.
Bilder von Personen sind auch personenbezogene Daten – das Datenschutzrecht kommt vor allem dann zum Tragen, wenn Fotos aufgenommen werden.“
Daniela Heggmaier: Stichwort Kuratieren von Inhalten: Wenn ich interessante Blogartikel oder Medienberichte teilen möchte – was muss ich beachten?
Dr. Marc Maisch: „Zum einem gilt beim Teilen von anderen Beiträgen dasselbe wir bei dem Verlinken (vgl. oben). Das heißt, sobald etwas mit Gewinnerzielungsabsicht geteilt wird, muss eine kurze Vorprüfung vorgenommen werden, ob der geteilte Inhalt eine Rechtsverletzung beinhaltet. Zu beachten sind an dieser Stelle v.a. das Urheberrecht. Soweit Texte als eingebettete Inhalte aus einer allgemein zugänglichen Quelle verlinkt werden, ist das Kuratieren in der Regel kein Problem. Nicht allgemein zugängliche Quellen wären geschlossene Gruppen oder Foren oder Bezahlbereiche von Zeitungen. Ein No-Go ist natürlich, veröffentlichte Medienberichte abzufotografieren und diese Fotos zu veröffentlichen oder Texte zu speichern und Kopien davon zugänglich zu machen.“
Daniela Heggmaier: Was müssen Selbstständige in ihrer Selbst-PR beachten?
Dr. Marc Maisch: „Wer als Selbstständiger eine überwiegend beruflich genutzte Website hat oder einen entsprechenden Social-Media-Account, muss Eigenwerbung nicht als Werbung kennzeichnen – denn es ist in der Regel klar, dass berufliche Auftritte Werbung enthalten. Im Übrigen gilt es, wettbewerbsrechtliche Grundregeln und allgemeine Gesetze zu beachten. Im Zweifel lohnt ein Blick ins Gesetz: Die Anlage zu § 3 UWG, die sogenannte Schwarze Liste, enthält einen Katalog an Werbeverboten, die zu beachten sind. Eigenwerbung sollte zudem stets inhaltlich richtig sein und keine unzulässige Alleinstellungs- oder Spitzendarstellungswerbung enthalten.“
Daniela Heggmaier: Was müssen Angestellte, die auch im Namen ihres Unternehmens kommunizieren, in ihrer Selbst-PR beachten?
Dr. Marc Maisch: „Angestellte eines Unternehmens müssen immer klar trennen, von welchem Account sie was veröffentlichen. Unternehmer sollten im Rahmen einer Social-Media-Richtlinie die Eckpfeiler der Außenkommunikation im Namen des Unternehmens definieren. Wer erkennbar als Arbeitnehmer eines Unternehmens auch private Beiträge verfasst, sollte diese – je nach Inhalt – eindeutig von seinem Arbeitgeber abgrenzen, etwa wie ‚Es ist meine persönliche Ansicht, dass…‘. Wenn nicht zweifelsfrei klar ist, ob ein Arbeitnehmer zu privaten oder beruflichen Zwecken bloggt, kann es sein, dass Arbeitgeber im Wege der sogenannten ‚Beauftragtenhaftung‘ gem. § 8 UWG für Rechtsverletzungen ihrer Arbeitnehmer (mit-)haften, selbst wenn sie nichts von diesem Beitrag wussten.“
Daniela Heggmaier: Stichwort Identitätsdiebstahl: Wie kann man vorbeugen? Was ist zu tun, wenn z.B. Instagram Profile oder Blogs kopiert werden?
Dr. Marc Maisch: „Lassen Sie mich noch früher einsteigen: Identitätsdiebstahl ist der Missbrauch von personenbezogenen Daten (Identität). Das können z.B. der Name in Kombination mit dem Geburtsdatum, Adresse oder Bankdaten sein. Anders als in den USA ist Identitätsdiebstahl in Deutschland kein eigener Straftatbestand.
Die Strafbarkeit richtet sich nach der Tathandlung: Wer eine Unterschrift fälscht und bei der Bank des Opfers veranlasst, dass die Handy-Nummer zum Versand der TAN-Nummer geändert wird, begeht eine Urkundenfälschung, § 267 StGB, und eine Fälschung beweiserheblicher Daten, § 269 StGB. Fälle wie dieser, in Dritte die Identität des Opfers missbrauchen, um Straftaten zu begehen, häufen sich leider derzeit sehr. Privatpersonen werden in der Regel Opfer von Betrugs- und Computerbetrugsdelikten aus dem Warenwirtschaftssektor. Bestellungen bei Online-Versandhändlern werden mit der Bonität der Opfer bestellt und an falsche Adressen geliefert oder bei Nachbarn abgegeben und von Mittätern abgeholt, die sich als Verwandte des Opfers ausgeben.
Daneben trifft es besonders kleine und mittelständische Unternehmen, die ihr Payment-Geschäft über unsignierte, unverschlüsselte E-Mails abwickeln. In einem meiner aktuellen Fälle von sogenanntem CEO-Fraud (= Geschäftsführer-Betrug) hatten sich Täter mit gefälschten, unauffälligen E-Mails über Monate lang tief in die CC-Korrespondenz zwischen Buchhaltung und Geschäftsleitung meiner Mandantschaft und einem ausländischen Dienstleister eingeklinkt und die digitalen Identität der Kommunikationspartner angenommen. Da auf E-Mails mit der „Antwort-Funktion“ geantwortet wurde und die Täter E-Mail-Adressen verwendeten, die bis auf einen Buchstaben identisch waren, schöpfte keiner der Beteiligten Verdacht. Die Täter schlugen in der stressigen Vorweihnachtszeit zu, indem die vermeintliche Änderung eines Rechnungskontos per E-Mail mitgeteilt wurde. Meine Mandantschaft wurde entsprechend getäuscht und überwies 13.000 US-Dollar auf ein unbekanntes ausländisches Konto. Der Betrug fiel erst im Januar auf, als der ausländische Dienstleister eine Zahlungserinnerung schickte.
Die Methoden der Täter, personenbezogene Daten automatisiert und systematisch zu sammeln und zu digitalen Identitäten anzureichern, sind genauso vielfältig, wie die möglichen Risiken für Opfer. Gemeinsam mit einem Team aus Cybercrime-Experten, u.a. von der Kripo München, beraten wir Medienschaffende, Unternehmer und Behörden, bewerten Risiken und zeichnen Lösungs- und Abwehrstrategien auf. Dabei gilt, ganz gleich ob für Nutzer privat oder in beruflicher Funktion:
Achten Sie auf IT-Sicherheit Ihrer Geräte, aktuelle Software- und Hardwareupdates sind Pflicht, verwenden Sie Passwortmanagersoftware, die jedem Account ein eigenes, sicheres Passwort zuweist. Finger weg von unverschlüsselten, offenen WLANs und leisten Sie sich einen VPN-Tunnel. Handy-PINs sollten sechsstellig sein. Vermeiden Sie, an öffentlichen Orten (Zug, Flughafen etc.) über Kollegen, ihr Geschäft oder ihr Privatleben zu sprechen – alle hören zu (jemand wie ich beginnt dann sofort zu googlen, wie Sie heißen könnten und herauszufinden, wo Sie morgen pitchen wollen).
Selbstdatenschutz: Nicht nur Ihre Kredit- und Bankdaten bedürfen besonders Augenmerk. Vermeiden Sie, dass Ihr Geburtsdatum für alle Welt offen auf LinkedIn usw. abrufbar ist, schützen Sie hier Zuhause und vermeiden Sie Postings aus dem Urlaub, die Einbrecher und Versandbetrüger auf den Plan rufen können.
Alles Böse kommt per E-Mail: Seien Sie wachsam, öffnen Sie keine dubiosen Links oder Inhalte (auch nicht dann, wenn Sie meinen, die IT-Sicherheit im Unternehmen müsste ja jeden Virus abwehren können). Informieren Sie sich, wer was über Sie weiss: Bei Auskunfteien und Unternehmen können Sie kostenlos einen Anspruch auf Auskunft über Ihre dort gespeicherten Daten geltend machen – ist etwas falsch gespeichert, können Sie Berichtigung oder ggf. Löschung verlangen. Im beruflichen Umfeld rate ich dazu, die IT-Sicherheit von externen Auditoren überprüfen zu lassen und IT-rechtliche Themen, wie z.B. Datenschutz, die Bewertung von Schutzmaßnahmen, Social-Media-Guidelines, Geheimnisschutz usw. von einem Rechtsanwalt überprüfen und ggf. nachbessern zu lassen. Die aktuelle Entwicklung im Bereich der Internetkriminalität zeigt deutlich: Datenschutz und IT-Sicherheit werden in der Zukunft nicht bloß Wettbewerbsvorteile darstellen, sondern existentiell sein, um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern.“
Daniela Heggmaier: Kaum haben wir die DSGVO überlebt, stehen schon die ePrivacy Verordnung und das Leistungsschutzrecht (Artikel 13) vor der Türe. Was müssen Selbstständige und Angestellte heute darüber wissen?
Dr. Marc Maisch: „Die Netzpolitik wird seit März 2018 vom Upload-Filter-Gespenst in Angst und Schrecken versetzt. Nicht ganz zu Unrecht. Lässt es Medienschaffende hängen? Worum geht’s da eigentlich? Eine Zusammenfassung der Fakten und Kritikpunkte:
Der Artikel 13 der geplanten Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt regelt die damit verbundenen Upload-Filter. Nach Fehlversuchen und Nachverhandlungen war es nun am 13.02.2019 so weit: Der Trialog zwischen EU-Parlament, -Rat und -Kommission konnte sich auf einen finalen Entwurf einigen. Ende März sollte das Votum der Mitgliedstaaten erfolgen. Die finale Abstimmung der Mitgliederstaaten über die Urheberrechtsreform erfolgt zwischen dem 25. bis 28.03.2019. Seit der Verkündung Mitte Februar gehen Tausende von jungen Menschen in Europa gegen den Art. 13 auf die Straße, um die Politik doch zu einem Umdenken zu bewegen.
Der geplante Art. 13 der Richtlinie ermöglicht es Rechteinhaber, Plattformbetreiber wie YouTube oder 9gag für jede Urheberrechtsverletzung, die auf der Plattform stattfindet, in Anspruch zu nehmen. Daher müssten Plattformbetreiber – aus eigenem Interesse – in Zukunft sämtlichen hochgeladenen Content auf Urheberrechtsverletzungen überprüfen und entsprechend filtern. Wie eine automatisierte Überprüfung von Satire, Kritik oder Berichterstattung durch Zitatrecht aussehen soll, ist unklar – die TITANIC-Redaktion hat hier sicher schon etwas vorbereitet, um Upload-Filter zu (ver)stören.
Da die automatisierte Filterung rechtlich und technisch viele Fragen aufwirft, befürchten Kritiker, dass Medienhäuser gegenüber Medienschaffenden beim Upload bevorzugt werden könnten. Die Frage, ob eine Stärkung der Urheberrechtsinhaber letztlich das ‚Ende des freien Internets‘ bedeuten muss, oder ob es sich um Panikmache handelt, lässt nicht abschließend beurteilen. Art. 13 hat sicherlich Vor- und Nachteile. Wer urheberrechtlich geschützte Inhalte veröffentlicht, sollte besser vor Urheberrechtsverletzungen geschützt werden. Gleichwohl sollte es doch im Sinne des Allgemeinwohls möglich bleiben, Neuschöpfungen und Remixes zu verbreiten.
Medienschaffende, Influencer und Social-Media-Agenturen werden sich wohl darauf einstellen müssen, ihre Schöpfungsprozesse noch genauer überwachen zu müssen: Eine Rechteverwaltung (auch für das Recht am eigenen Bild der Abgebildeten), eine klare Festlegung von Stakeholdern und Qualitätsmanagementprozessen kann dabei helfen, beim Upload Probleme zu bekommen. Rechtliche Tücken, unvollständige Lizenzdatenbanken und Ärger mit Upload-Filtern usw. werden aber [leider] im wahrsten Sinne des Worts vorprogrammiert sein…“
Daniela Heggmaier: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch!
Zur Person
Dr. Marc Maisch ist Rechtsanwalt und Datenschutzbeauftragter mit Sitz in München. Er berät bundesweit zu allen Fragen des Internet- und Datenschutz- und Vertragsrechts. Agenturen, Influencer und Unternehmen berät er auch im Urheber- und Marketingrecht.
Er hat mehr als 50 Fachveröffentlichungen und drei Bücher zum IT- und Datenschutzrecht publiziert und schreibt gerade an seinem Handbuch „Datenschutz im Cloud Computing“ für den O’Reilly-Verlag. Seit 2017 ist Herr Dr. Maisch Rechtsanwalt in eigener Kanzlei und Ansprechpartner für IT- und Social-Media-Recht bei Blackstone432. Weitere Informationen unter www.mms-law.de.
Vortragsthemen von Dr. Marc Maisch
für Schüler-, Eltern- oder Lehrerfortbildungen:
- Cybercrime – Gefahren aus dem Netz (dt./ engl.)
- Datenschutz und Identitätsdiebstahl (dt./ engl.)
- Internetrecht für Kinder: Was darf ich (nicht) bei WhatsApp, Instagram und YouTube?
für Unternehmen, Verbände und Institutionen:
- Neue Angriffe auf Führungskräfte: CEO-Fraud, Social Engineering, Darknet – Fälle, Risiken, Rechtsberatung (dt./ engl.)
- Influencer Marketing im Unternehmen – Chancen und Haftungsfragen
- Best Practice DSGVO und Vertragsgestaltung
- Social-Media-Marketing und Recht
Hier finden Sie Downloads zu der Veranstaltung „IHK netzblicke“ am 22.11.2018
„Chancen und Fallstricke beim Corporate Influencer Marketing“
- Corporate Influencer: Die neuen Superhelden am Kommunikationshimmel? PDF zum Vortrag von Daniela Heggmaier
- Rechtliche Rahmenbedingungen des Corporate Influencer Marketings PDF zum Vortrag – von Dr. Marc Maisch, Rechtsanwalt, MMS-Law